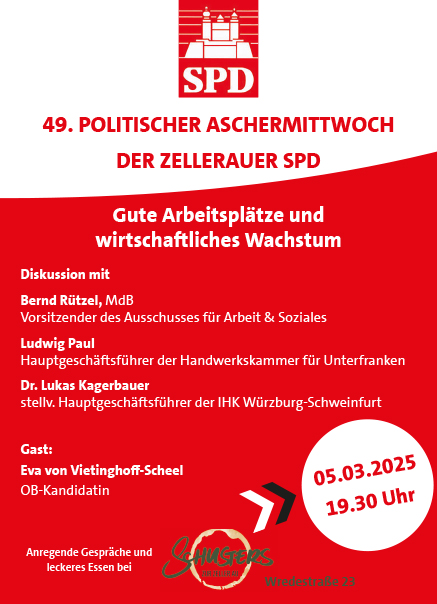
Unsere Demokratie stärken! Deine Stimme zählt! Am 23.02. wählen gehen!
Sichere Renten gibt es nur mit der SPD!
Eine sichere und gute Altersversorgung ist für alle Generationen von existenzieller Bedeutung.
Die Anerkennung von Arbeit spiegelt sich auch in guten Renten. Das gilt auch für die Generation, die jetzt in´s Erwerbsleben kommt und viele Jahre Beiträge zahlen wird.
Eine gute Absicherung im Alter ist ein Kernversprechen unseres Sozialstaats. Doch Friedrich Merz und die Union sehen das anders, sie wollen die Rente nach 45 Beitragsjahren abschaffen und stellen das Renteneintrittsalter infrage. Ihre Weigerung das Rentenniveau zu stabilisieren ist eine Rentenkürzung durch Unterlassen. Sichere Renten gibt es nur mit der SPD!
Das Regierungsprogramm der SPD beinhaltet klare Vorhaben für die Rentenpolitik, die Rentner*innen von heute und morgen Sicherheit bietet: Stabilisierung der Rentenversicherung, Sicherung des Rentenniveaus, abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und Einbeziehung Selbständiger. Die Sicherung der Rente für alle Generationen ist neben Wirtschaftswachstum und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie der Entlastung von Familien und Beschäftigten einer der drei klaren Schwerpunkte des SPD-Wahlprogramms.
Maßnahmen für stabile und zukunftssichere Renten
Um das Rentensystem zukunftsfest zu machen, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in Beschäftigung sind. Fachkräftesicherung und Arbeitsmarktpolitik sind auch immer Rentenpolitik.
Für die SPD umfasst dies neben einer Stärkung der Tarifbindung für gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen auch eine bessere Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, damit mehr junge Menschen erfolgreich ins Berufsleben starten, Beschäftigte mit dem Wandel in der Arbeitswelt Schritt halten können, Hilfs- zu Fachkräften qualifiziert werden können und Langzeitarbeitslose eine neue Perspektive bekommen.
Dies umfasst ebenso eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, einen inklusiven Arbeitsmarkt, damit Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und gleichberechtigt am Arbeitsleben teilhaben können, sowie eine erfolgreiche Integration von Fachkräften aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt.
Dafür hat die SPD-geführte Bundesregierung gearbeitet und Verbesserungen eingeführt. Ebenso wie mit der Erhöhung des Mindestlohns, dem höheren Kindergeld, mehr Mitteln für den sozialen Wohnungsbau, der Aufholjagd bei wichtigen Zukunftstechnologien wie Batterien oder Computerchips, höheren Investitionen in die Bahn, dem Deutschlandticket und dem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien konnte in den vergangenen drei Jahren viel erreicht werden. Die SPD ist die „Kraft der Mitte“ und des „gesunden Menschenverstandes“, die „Stimme der Fleißigen und Anständigen“.

